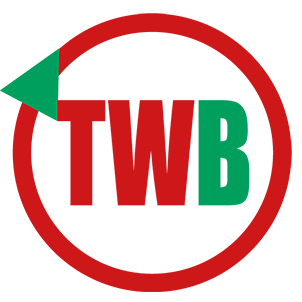Wartung von Trinkwarmwasserspeichern durch TWB

Die häufigste Verwendung eines zentralen Trinkwarmwasserspeichers ist die Verwendung als Bestandteil einer Zentralheizung. Derartige Trinkwarmwasserspeicher kommen oftmals in Wohnanlagen oder Wohnhäusern mit zentraler Trinkwarmwasser-Versorgung zum Einsatz.
Dabei kann ein derartiger Trinkwarmwasserspeicher mit einer beliebigen Heizungsanlage d.h. zum Beispiel einer Wärmepumpe, einer Ölheizung oder einer Gastherme kombiniert werden.
Hierbei wird der Trinkwarmwasserspeicher üblicherweise so nah wie möglich am Heizkessel positioniert, um einen Anteil des erwärmten Wassers – welches aktuell nicht für die Heizung benötigt wird – als Ressource für den Trinkwarmwasserspeicher bereit zu stellen.
Die vom Kessel erzeugte Wärmeenergie wird nun nicht nur über die Heizungsleitungen an die einzelnen Heizkörper verteilt, sondern auch mittels eines sogenannten Wärmetauschers an das Trinkwarmwasser weitergegeben und im Trinkwarmwasserspeicher gespeichert.
Nach den VDI 6023 Richtlinien und der DIN1988 Teil 8 sollten Trinkwarmwasserspeicher jährlich einer Inspektion unterzogen werden und sollten vor allem regelmäßig gewartet werden.
So wird auch empfohlen alle zwei Jahre die Trinkwasser-Erwärmungsgruppen zu reinigen, zu desinfizieren und zu beproben.
Wer bereits einmal das Innenleben eines älteren Trinkwarmwasserspeichers begutachtet hat, weiß welche Ablagerungen sich auf den Heizelementen, dem Wärmetauscher und den Speicherinnenflächen befinden.
Die Vermehrung von Legionellen findet vor allem auf der Innenoberfläche der verschmutzen Leitungsnetze oder in den Trinkwarmwasserspeichern statt.
In dem aus Schlamm und Kalk sowie Korrosionsrückständen verunreinigten zentralen Trinkwarmwasserspeicher kann relativ schnell ein Oberflächenbewuchs (Biofilm) entstehen von dem eine stetige Kontamination an das Trinkwasser ausgeht. Nicht ausreichende Temperaturen im Trinkwarmwasserspeicher oder in den Warmwasserleitungen bzw. Zirkulationsleitungen begünstigen den Oberflächenbewuchs (Biofilm) und die Legionellenbildung.
Außerdem führen die mit Rückständen belegten Heizwendeln bzw. Wärmetauscher innerhalb des Speichers zu einem größeren Energieverlust, der wiederrum eine verschlechterte Wärmeabgabe des Heizmediums an das Trinkwarmwasser zur Folge hat.
Weiterhin kommt es in der Regel zu einer erheblichen Verminderung der Schüttleistung (Kapazität) des Trinkwarmwasserspeichers, die sich in Spitzenzeiten durch nicht ausreichend erwärmtes Wasser bemerkbar macht.
Obwohl moderne Trinkwarmwasserspeicher oftmals als wartungsarm bezeichnet werden, unterliegen einige Elemente wie die Korrosions-Anode einem stetigen natürlichen Verschleiß.
Die ständige Bereithaltung des warmen Wassers begünstigt außerdem die Bildung von Kalk.
Für eine einwandfreie und sichere Funktion ist deshalb eine regelmäßige Wartung unumgänglich.
Gerade wenn der Warmwasserspeicher der Trinkwarmwasser-Versorgung, dient ist die Reinigung und Wartung aus gesundheitlichen Gründen stark anzuraten.
Ablauf einer Wartung eines Trinkwarmwasserspeichers
Entkalkung und Reinigung
 In unserem Trinkwasser sind Mineralien wie zum Beispiel Calzium und Magnesium enthalten.
In unserem Trinkwasser sind Mineralien wie zum Beispiel Calzium und Magnesium enthalten.
Diese und weitere Mineralien finden sich dann auch in gelöster Form in unserem Leitungswasser wieder. Durch Erwärmung des Wassers scheiden sich diese Mineralien wieder aus und setzen sich an den Heizstäben, am Wärmetauscher oder in den Rohrleitungen fest.
Diese Ablagerungen werden allgemein als Kalk bezeichnet.
Kalk wirkt auch als Wärmeisolator. Diese Eigenschaften sind bei einem Trinkwarmwasserspeicher nicht erwünscht, da Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. dem Wärmetauscher dazu führen können, dass die Wärme nicht genügend schnell ans Wasser abgegeben werden kann. Dadurch wird die Effizienz der Trinkwarmwasserbereitung stark herabgesetzt und Energie geht verloren. Weiters reduziert sich der Wirkungsgrad durch die Kalkablagerungen und es steht weniger Warmwasser zu Verfügung als wenn der Trinkwarmwasserspeicher neu und noch nicht verkalkt ist.
Entfernen der „Sumpfes“ im Trinkwarmwasserspeicher
Kleine Fremdpartikel die mit dem Trinkwasser mit eingeschwemmt werden, setzen sich zusammen mit Kalk am Boden des Trinkwarmwasserspeichers ab. Über die Jahre entsteht dadurch auf dem Grund der sogenannte „Boilersumpf“ der auch einen idealen Nährboden für Bakterien darstellt. Um dies zu verhindern sollte der „Boilersumpf“ regelmäßig im Zuge der Wartungsarbeiten entfernt werden.
Schutzanoden bzw. Opferanoden sollten im Rahmen der Wartung geprüft und ggf. ersetzt werden
Die Schutzanode bzw. Opferanode ist prinzipiell ein metallisches Werkstück das Trinkwarmwasserspeicher vor Korrosionsschäden bewahren soll. Es besteht in der Regel aus stabförmigem Magnesium, das direkt im Trinkwasserspeicher steckt.
Die Opferanode ist unedler als die Baumaterialien des Trinkwarmwasserspeichers und wird daher zuerst vom Rost befallen.
Es wird also zuerst das unedlere Metall „geopfert“ um den Speicher zu schützen. Aus diesem Grund trägt das Bauteil auch den Namen „Opferanode“.
Wirkprinzip der Schutzanode bzw. Opferanode im Trinkwarmwasserspeicher
Kommen Metalle in Kontakt mit Wasser und Sauerstoff, bildet sich eine sogenannte galvanische Zelle (auch galvanisches Element). Dabei reagiert der Sauerstoff mit dem Material. Das Eisen oxidiert und gibt Elektronen ab. Es bildet sich Rost und die Werkstoffe zersetzen sich allmählich. Mit einer Opferanode passiert das nicht. Denn hier löst sich anstelle des Trinkwarmwasserspeichers die unedlere Magnesiumanode auf. Die freien Metallteilchen wandern dann über das Wasser (den Elektrolyten) zu den Trinkwarmwasserspeicher-Wandungen, die sich bei dieser Anordnung nicht mehr abbauen.
Die Fremdstromanode zum Schutz vor Korrosion
Neben der Opferanode bzw. Schutzanode gibt es heute alternative Lösungen zum Korrosionsschutz die bereits bei verschiedenen Herstellern von Trinkwarmwasserspeichern zum Einsatz kommen. Weit verbreitet ist dabei bereits die sogenannte Fremdstromanode, die ebenfalls aus einem stabförmigen Metall besteht. Wie der Name bereits vermuten lässt, sind Fremdstromanoden an eine externe Stromquelle angeschlossen. Sie liefern somit einen Elektronenüberschuss, der die Speicherwandungen wirksam vor Korrosion schützt. Der Vorteil liegt darin, dass sich weder Schutzanode noch Speicher bei dieser Variante verzehren. Das senkt die Wartungskosten, verursacht allerdings höhere Ausgaben für den verbrauchten Strom. Im Zuge der Wartung sollten diese sogenannten Fremdstromanoden aber auch stets kontrolliert werden.
Flanschdichtungen des Trinkwarmwasserspeichers im Rahmen der Wartung überprüfen und wenn nötig ersetzen
Dichtungen können über die Jahre spröde und undicht werden, Wärme beschleunigt die Alterung der Dichtung zudem. Eine undichte Stelle kann schnell einen Wasseraustritt mit weiteren Schäden zur Folge haben. Aus diesem Grund sollten die Flanschdichtungen des Trinkwarm-wasserspeichers zumindest bei jeder Entkalkung ersetzt werden
Kontrollieren der Temperatureinstellung im Zuge der Wartung des Trinkwarmwasserspeichers
Die ideale Betriebstemperatur eines zentralen Trinkwarmwasserspeichers beträgt zwischen 60°C und 65°C. Zu hohe Temperaturen erhöhen die Kalkablagerung und verkürzen so den Wartungsintervall. Zudem bedeutet eine höhere Betriebstemperatur auch einen höheren Energieverbrauch.
Temperaturen unter 60°C sollten aber auch vermieden werden, denn diese ermöglichen, dass Bakterien sich vermehren können. Aus diesem Grund sollten die Einstellungen des Trinkwarmwasserspeichers im Zuge der Wartung kontrolliert und ggf. neu eingestellt werden.