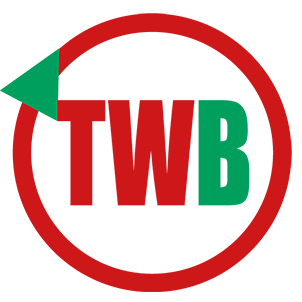Wartung von Heizungs- und Kühlungssystemen auf Basis einer Betonkernaktivierung der Bodenplatte
durch TWB-Spezialisten
 Bei der Betonkernaktivierung (auch Betonkerntemperierung oder thermische Bauteilaktivierung) werden in der Bodenplatte Kunststoffrohre eingegossen, die zur Heizung im Winter und zur Kühlung im Sommer genützt werden.
Bei der Betonkernaktivierung (auch Betonkerntemperierung oder thermische Bauteilaktivierung) werden in der Bodenplatte Kunststoffrohre eingegossen, die zur Heizung im Winter und zur Kühlung im Sommer genützt werden.
Dieses System wird Betonkernaktivierung oder auch thermische Bauteilaktivierung genannt. Diese Betonteile fungieren dabei als Heizflächen und kommen durch ihre Größe mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen aus.
Der Beton dient hierbei grundsätzlich nicht nur der Standfestigkeit der Bodenplatte, sondern auch zur Energiegewinnung bzw. -speicherung, da er ein sehr hohes Wärmespeichervermögen besitzt und eine hohe Dauerhaftigkeit aufweist
Mit diesem System kann die Bodenplatte eines Bauwerks oder eines Geschosses je nach Auslegung zum Heizen im Winter oder auch zur Kühlung im Sommer verwendet werden.
Die gesamte durchflossene Bodenplatte wird dabei als Übertragungs- und Speichermasse thermisch aktiviert.
Die so aktivierte Bodenplatte kann je nach Heizungsverwendung oder Kühlungsverwendung Wärme / Kälte aufnehmen oder abgeben.
Aufgrund der vergleichsweise großen Übertragungsfläche können die Systemtemperaturdifferenzen niedrig bleiben, sodass die Bodenplatte nicht so stark erwärmt / gekühlt werden muss wie beispielsweise bei anderen Heizungssystemen oder Kühlungssystemen der Fall ist.
Aufgrund dieser geringeren Vorlauftemperaturen können zum Heizen oder Kühlen z.B. Wärmepumpen auf effiziente Art und Weise eingesetzt werden.
Die vergleichsweise geringe Heizleistung verlangt jedoch häufig ein weiteres Heizsystem.
Betonkernaktivierung eignet sich auch zur Kombination mit erneuerbaren Energien
Da sich die Heizflächen bei der thermischen Bauteilaktivierung über das gesamte Gebäude erstrecken, kommen die Systeme mit Vorlauftemperaturen von 22 bis 28 Grad Celsius aus. Besonders günstig ist das für regenerative Energiesysteme wie Wärmepumpen und thermische Solaranlagen. Erstere müssen das Temperaturniveau der Umweltwärme kaum anheben und verbrauchen dadurch sehr wenig Strom. Solarthermieanlagen, die vor allem in der Übergangszeit nur geringe Systemtemperaturen erreichen, lassen sich hingegen länger effektiv einsetzen, um das Gebäude zu beheizen. Beide Systeme sparen Energiekosten und haben prinzipiell eine hohe Energieeffizienz.
Energieeffiziente und sparsame passive Kühlung im Sommer
Während die Betonkerntemperierung (zur Heizung) im Winter mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommt, können die Kühlwassertemperaturen im Sommer vergleichsweise hoch sein. Sie liegen selten unter 16 bis 18 Grad Celsius, was vor allem die energiesparende passive Kühlung begünstigt. Dabei leiten Pumpen beispielsweise Grundwasser durch die Anlage, um Wärme aufzunehmen und abzuführen. Kommen Sole-Erdwärmesonden zum Einsatz, lässt sich das Erdreich dabei im Sommer erwärmen, um im Winter vom angelegten Energiereservoir zu zehren. Denn dann bekommen Wärmepumpen höhere Temperaturen aus dem Boden. Der nötige Temperaturhub ist geringer und die Anlagen verbrauchen weniger Strom.
Speichermasse gleicht Schwankungen im Energieangebot aus
Wichtig ist aber, dass man bezüglich des Systems der Betonkernaktivierung weiß, dass die hohe Speichermasse auch mit einer enormen Trägheit einhergeht. Dementsprechend dauert es lange, bis geänderte Temperaturanforderungen tatsächlich im Raum spürbar sind. Aus diesem Grund lohnen sich Programme wie die Nachtabsenkung mit der Betonkernaktivierung kaum.
Heiz- und Kühlleistung ist geringer als bei anderen Systemen
Ein Manko der Betonkernaktivierung ist die Heizleistung, die mit 30 Watt pro Quadratmeter vergleichsweise niedrig ist. Sie reicht in der Heizperiode teilweise nur zur Temperierung und setzt dann die Kombination mit anderen Heizsystemen voraus. So ist es beispielsweise üblich, die thermische Bauteilaktivierung mit einer Fußboden- oder Deckenheizung zu kombinieren. Während Erstere das Gebäude immer auf einer Grundtemperatur hält (temperiert), sorgt das zusätzliche Heizsystem in der Heizperiode für eine höhere Leistung und eine bessere Regelbarkeit.
Kühlung im Sommer mittels Betonkernaktivierung
Im Sommer erfolgt die Absenkung der Raumtemperatur durch die Zirkulation von kaltem Wasser im Leitungssystem. Diese Wirkungsweise ist jedoch nicht mit der eines Klimagerätes vergleichbar. Aufgrund der schon erwähnten Trägheit des Systems erfolgen Temperaturänderungen langsam. Es ist daher nicht ratsam, laufend Temperaturen an den Thermostaten zu ändern. Die Steuerung bzw. Bedienung erfolgt über Raumthermostate, die sich in der Regel in den Aufenthaltsräumen über den Lichtschaltern befinden. Mit ihnen lässt sich die Temperatur raumweise steuern. Es empfiehlt sich, hier eine definierte Temperatur über einen längeren Zeitraum beizubehalten. Das System reagiert auf Temperaturänderungen langsam, daher werden Änderungen erst zeitversetzt wirksam.
Der zentrale Verteiler befindet sich in der Regel an der Decke in den WC’s oberhalb einer Wartungsklappe. Neben dem Verteiler befindet sich auch ein Schalter. Dieser dient zum manuellen Umschalten von Kühl- auf Heizbetrieb. Dieser muss immer am Übergang von der Heiz- auf die Kühlperiode betätigt werden.
Bei gewissen Wetterlagen oder in Übergangszeiten, wo es zu raschen Temperaturänderungen kommt kann jedoch die Situation entstehen, dass die Heizung oder Kühlung durch ihre Trägheit nicht so rasch auf die gegebenen Änderungen reagiert. Die Raumtemperatur kann deshalb in diesen Perioden als zu hoch empfunden werden.
Wartung von Heizungs- / Kühlungssystemen, die auf Bauteilaktivierung basieren, durch TWB
 Auch Heizungssysteme, die auf Betonkernaktivierung bzw. Bauteilaktivierung basieren, benötigen eine regelmäßige Wartung, damit die hohe Energieeffizienz und der günstige Betrieb dieses Heizungssystems auch dauerhaft sichergestellt ist.
Auch Heizungssysteme, die auf Betonkernaktivierung bzw. Bauteilaktivierung basieren, benötigen eine regelmäßige Wartung, damit die hohe Energieeffizienz und der günstige Betrieb dieses Heizungssystems auch dauerhaft sichergestellt ist.
Die im Beton verlegten Rohre dürfen keinesfalls durch Anbohren beschädigt werden.
Es ist vor allem sehr wichtig, dass die im Beton verlegten Rohre nicht beschädigt werden. Bohren in der Decke ist daher nur im Bereich der Deckenauslässe für die Leuchten innerhalb eines Radius von (z.B. maximal 10 cm) möglich. Nur innerhalb dieses Radius können seitens des Wohnungsmieters einfache Deckenleuchten und Hängeleuchten befestigt werden. Auch das Bohren im Fußboden sollte sich nur auf Bereiche beschränken in denen keine im Beton eingelegten Kunststoffrohre liegen. Die Montage von Lichtsystemen (z.B. Beleuchtungsstangen) ist üblicherweise nicht gestattet. Alternativ besteht die Möglichkeit des Klebens. Dafür ist die Malerei und Spachtelung in dem angedachten Bereich zu entfernen und die Verarbeitungsrichtlinien des Klebematerials zu beachten.
Im Fall, dass es trotzdem zu einer Beschädigung der im Beton verlegten Rohre kommt gibt es üblicherweise in jeder Wohnung ein Ventil mit dem die betroffene in den Beton führende Leitung, abgesperrt werden kann.
Wartung von Heizungssystemen / Kühlungssystemen, die auf Bauteilaktivierung basieren: die Heizungswasser- bzw. Kühlungswasserqualität ist von hoher Bedeutung für eine hohe Energieeffizienz bzw. für eine lange Haltbarkeit dieses Heizungssystems.
Heizungssysteme, die auf Bauteilaktivierung basieren, funktionieren nur dann einwandfrei, wenn im Rohrnetz, welches das Heizwasser in Vor- und Rücklauf transportiert, ideale Werte vorliegen. Das bedeutet, es muss genügend Wasser im System zirkulieren, um einen genügend hohen Druck zu gewährleisten.
Wichtige Faktoren, damit eine Heizungs- / Kühlungsanlage, die auf Bauteilaktivierung basiert, für eine lange Zeit energieeffizient läuft und eine lange Lebensdauer erreicht
Um sicherzustellen, dass die auf Bauteilaktivierung basierende Heizung auch für eine lange Zeit verlässlich und störungsfrei ihren Dienst erfüllt, ist die Qualität des Heizungswassers ein entscheidender Faktor. Wird der Aufbereitung des Heizungswassers bei Heizungssystemen / Kühlungssystemen, die auf Bauteilaktivierung basieren, keine Beachtung geschenkt kommt es bei Verwendung von konventionellem Leitungswasser schnell zu nachfolgenden Effekten im Heizungssystem:
- Ablagerung von Kalk oder Schlamm
Bei höheren Temperaturen – wie sie eben in einer Heizung zu finden sind – lagert sich Kalk sehr leicht ab. Die Kalkschichten, die so entstehen, lassen die Wärme schwerer nach draußen. Damit ein Heizungseffekt / Kühlungseffekt eintritt muss man also mehr einheizen / kühlen und braucht somit mehr Energie. Eine Kalkschicht von nur 1 mm erhöht den Energieverbrauch um bereits um rund 10 Prozent.
Die Kalkpartikel, die im Wasser gelöst sind, lagern sich im gesamten Leitungsnetz und auch in den Kunststoffrohren welche die Betonteile durchziehen ab und der Leitungsquerschnitt nimmt mit der Zeit ab. Dadurch sinkt die Durchflussrate vom warmen Heizungswasser bzw. vom kalten Kühlungswasser in den Kunststoffrohren welche die Betonteile durchziehen.
Durch den höheren Druckverlust muss zwangsläufig die Pumpenleistung der Heizungspumpe erhöht werden was zu höheren Kosten für Pumpenstrom führt.
Weiters können durch die Kalkablagerungen auch sehr schnell Ventile verstopfen die dann üblicherweise defekt werden und getauscht werden müssen.
Eine weitere Nebenwirkung der Kalk-Ablagerungen sind auch Biofilme, die sich in den Rohren bilden können und die ein idealer Nährboden für Bakterien darstellen.
- Korrosion der Rohre
Auch in Heizungsanlagen / Kühlanlagen die auf Bauteilaktivierung basieren kommen oft Metalle wie Eisen, Stahl, Aluminium oder Kupfer vor. Diese reagieren mit dem Heizungswasser / Kühlungswasser– es kommt zu Korrosion. Die wohl bekannteste Form der Korrosion ist der Rost bei Eisen. Außerdem werden die metallischen Teile einer Heizungsanlage / Kühlungsanlage auch von zu saurem Wasser angegriffen – also, wenn der pH-Wert unter 7 liegt. Sind dann noch der Salzgehalt und die Sauerstoffkonzentration im Wasser zu hoch, wird das auf Bauteilaktivierung basierende Heizungs- / Kühlungssystem noch schneller kaputt.
Weiters können die gelösten Metallpartikel in den Heizkreislauf / Kühlkreislauf gelangen und als sogenannter Korrosionsschlamm die ganze Anlage verstopfen.
- Luft in den Kunststoffrohren, die im Beton eingelassen sind.
Eine auf Bauteilaktivierung basierende Heizungsanlage / Kühlanlage ist zwar ein in sich geschlossenes System, trotzdem ist diese aber nie komplett luftdicht. Durch das Nachfüllen von Wasser, durch undichte Armaturen und Verbindungsteile oder durch die luftdurchlässigen Kunststoffrohre die Im Beton verlegt sind gelangt Luft in die Anlage. Zu viel Luft in der Anlage erschwert den Transport der Wärme mit dem Wasser und die thermisch aktivierten Betonteile werden nicht mehr richtig warm. Außerdem können durch Luft verursachte Geräusche – wie Klopfen oder Glucksen – mit der Zeit sehr ärgerlich und störend sein.
Neben technischen Problemen erwartet den Betreiber einer Heizungsanlage / Kühlungsanlage die auf Bauteilaktivierung basiert bei falscher Aufbereitung des Heizungsfüllwassers ein Garantieverlust für das Heizungssystem / den Heizkessel / die Wärmepumpe oder andere kostspielige Bauteile.
Alle Hersteller von Heizungssystemen die auf Bauteilaktivierung basieren schreiben in ihren Garantiebedingungen die für den Erhalt der Garantie notwendige Wasserqualität vor und berufen sich hierbei in vielen Fällen auf Richtlinienempfehlungen.
Aus diesen Gründen sollte in Heizungssystemen / Kühlungssystemen, die auf Bauteilaktivierung basieren, unbedingt auf Heizungswasser / Kühlungswasser geachtet werden, dass die nachfolgenden Eigenschaften hat:
- pH-Wert zwischen 8,2 und 10
- pH-Wert zwischen 8,2 und 8,5 bei Anwesenheit von Aluminiumlegierungen
- eine geringstmögliche Härte bzw. je größer das Wasservolumen im Verhältnis zum kleinsten Wärmeerzeuger und je höher die Gesamtheizleistung umso geringer sollte die Gesamthärte sein
- ein geringstmöglicher Sauerstoffgehalt und geeignete Maßnahmen zur Sauerstoffeliminierung bei konstruktiv bedingtem Sauerstoffeintrag
- eine geringstmögliche elektrische Leitfähigkeit zur Minimierung des Korrosionsrisikos, einhergehend mit einer niedrigen Konzentration an Chloriden und Sulfaten
- klares und sauberes Wasser, frei von Schwebstoffen und organischen Verunreinigungen
Um die obenstehende Qualität des Heizungswassers sicherzustellen sollte sich bei Heizungen, die auf Bauteilaktivierung basieren, eine Heizungswasseraufbereitung im Einsatz befinden, die auf den folgenden Technologien basiert:
- Enthärtung des Heizungsfüllwassers durch Ionentausch
- Vollentsalzung des Heizungsfüllwassers durch Ionentausch
- Vollentsalzung des Heizungsfüllwassers durch Osmose (Umkehrosmose),
- Vollentsalzung mit pH-Wert Anhebung
- klassischer Filtration des Heizungsfüllwassers zur Entfernung von Schwebstoffen sind die gebräuchlichsten Methoden der Heizungsfüllwasseraufbereitung
Jede der genannten Methoden ist prinzipiell zur Heizungsfüllwasseraufbereitung geeignet, erzeugt jedoch Wasser mit unterschiedlichem Charakter. Der Charakter ist ausschlaggebend für die Eignung als Füllwasser für die auf Bauteilaktivierung basierende Heizungsanlage / Kühlanlage.
Unsere TWB-Spezialisten richten sich bei der Durchführung der Wartungsarbeiten nach den Herstellerangaben bzw. führen die Wartungsarbeiten in Kooperation mit den Wartungsteams der jeweiligen Hersteller der Komponenten der auf Bauteilaktivierung basierenden Heizungsanlage / Kühlungsanlage durch und stellen so sicher, dass die Anlagen unter Wahrung der Herstellergarantie stets optimal und energieeffizient arbeiten können.