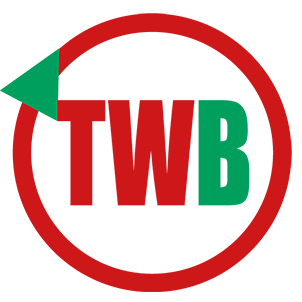Heizungswasseranalyse durch TWB
 Um Korrosionsschäden in Warmwasser-Heizungsanlagen zu vermeiden, legt die ÖNORM H 5195 das Augenmerk auf die Beschaffenheit des Heizwassers.
Um Korrosionsschäden in Warmwasser-Heizungsanlagen zu vermeiden, legt die ÖNORM H 5195 das Augenmerk auf die Beschaffenheit des Heizwassers.
Die ÖNORM H 5195 regelt das detaillierte Vorgehen und mit welchen Messgeräten die Heizwasseranalyse durchgeführt werden sollte.
Eine Heizwasseranalyse sollte bei Neuinstallation und Veränderung an der Heizungsanlage ausgeführt und danach prinzipiell einmal jährlich wiederholt werden.
Zusammenfassend wird bei einer Heizungswasseranalyse hauptsächliches Augenmerk auf die elektrische Leitfähigkeit, den pH-Wert und die Wasserhärte gelegt.
Es ist wichtig zu bedenken, dass bei neu installierten Heizungssystemen der pH Wert zeitversetzt (erst 8-12 Wochen nach dem Befüllen der Heizungsanlage) gemessen wird, da sich der pH-Wert in der Regel noch ändern kann.
Das hat den Grund, dass sich die Ionen aus der Beschichtung erst später in das Heizungswasser absetzen können.
Prinzipielle Durchführung einer Heizungswasseranalyse durch TWB
Für eine Heizungswasseranalyse sollte zuerst an einer geeigneten Stelle eine Wasserprobe entnommen werden. Dafür sollte die Zapfstelle gut durchgespült werden – dies bedeutet, dass das Stagnationswasser zuerst sorgfältig abgelassen wird.
Danach wird das Wasser in einen sauberen durchsichtigen Behälter gefüllt, ohne dass Luft in die Probe gelangt, um das Ergebnis z.B. für die pH- Wert Messung nicht zu verfälschen.
Ein erster Hinweis auf die Qualität des Heizungswassers erfolgt durch die Sichtprüfung. Die Probe sollte grundsätzlich klar und frei von Sedimenten sein.
Im Zuge der Analyse wird üblicherweise zuerst die elektrische Leitfähigkeit der Wasserprobe gemessen, die in µS/cm (Mikrosiemens) oder in mS/cm (Millisiemens) gemessen wird.
Je höher der Salzgehalt der Probe ist desto höher ist auch die Leitfähigkeit und die Wahrscheinlichkeit der Korrosion. Die Heizungshersteller geben mittlerweile immer öfter den Salzgehalt für ihre Komponenten bzw. ihre Anlage vor.
Die Leitfähigkeitssonde besteht in der Regel aus einem Elektrodenpaar, mit dem der elektrische Stromfluss gemessen wird. Zur Messung werden die Elektroden und der Temperatursensor in die Messprobe gehalten und der Messwert kann dann im Display abgelesen werden.
Danach wird in der Regel der pH-Wert derselben Messprobe ermittelt. Besonders gut eignet sich dafür eine Membran-Glaselektrode für diese Messung. Die Glaskugel gibt eine elektrische Spannung ab, die proportional zum pH-Wert ist.
Eine einfache Teststreifen-Messung kann für die Heizwasseranalyse in der Regel kein verlässliches Messergebnis liefern und sollte deshalb nicht zur Anwendung kommen
Da die elektrische Leitfähigkeit und der pH-Wert temperaturabhängig sind, müssen die Sonden über einen Temperatursensor verfügen, damit das Messgerät ein temperaturkompensiertes Ergebnis anzeigen kann.
Schließlich wird die Wasserhärte festgestellt. Dazu eignet sich eine Messung mit einem Titrierset. Dabei wird eine Flüssigkeit (Titrierlösung) in die Wasserprobe eingetropft, bis ab einer gewissen Tropfenmenge ein Farbwechsel von rot zu grün eintritt. Die Anzahl der Tropfen entspricht dann dem Grad deutscher Härte (dH).
Anstatt einer Heizungswasseranalyse von Ort mit den entsprechenden Messgeräten besteht aber auch die Möglichkeit, die luftdicht verschlossene Heizungswasserprobe in einem dafür spezialisierten Labor analysieren zu lassen.
Die Ergebnisse der Heizungswasseranalyse werden in der Anlagendokumentation elektronisch abgelegt.